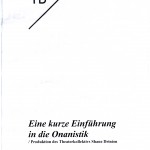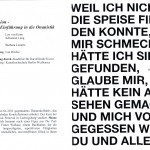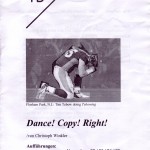Folge 1.034
Karl-Liebknecht-Boulevard, Bärlin Mitte. Herbst 2012.

Unter dem Grollschen Schreibtisch im siebenhundertsten Stockwerk eines teilabgerissenen DDR-Bürohauses am Liebknechtboulevard lugen zwei kleine Leoparden hervor – nein, es sind die Füße von Madame Groll; um ihren Hals geschnürt ein dazu passender Viskoseschal, auf der Fensterbank eine große Handtasche, ebenfalls in Leopardenfelloptik. Die Brille im Haar signalisiert: Wenn ihr genau genug hinseht, werdet ihr hier noch vieles weitere finden. Den einen oder anderen Gedanken zum Beispiel. Oder ein paar hübsche Ringelnattern. Man weiß es nicht.
Man könnte die Groll dazu befragen. Ihr Büro steht immer offen, zumindest seine Tür. Doch sollte man sich keine allzu großen Hoffnungen machen, Gehör zu finden, obschon man davon ausgehen kann, dass Madame Grolls Leopardenohren alles hören. Dass Kollege Konieczny zu spät zum Haftantritt erscheint, hat sie gehört, obwohl er wie auf Samtpfoten geht. Dass ich Prinzessin bin, hat sie gehört, weil ich es ihr gesagt habe. Zugehört hat sie freilich nicht, verstanden hat sie es dennoch. „Redebegabt“ nennt sie mich. Da kennt sie sich aus. Beispielsweise vermag sie ein vorwurfsvolles „Guten Morgen“ in kaum weniger als zwölf verschiedenen Nuancen zu fauchen. Wer je im Groll-Haus zu Gast war, wird sich in jedem Tiergehege der Welt zurechtfinden.
Wäre Madame Groll ein Leopard, wäre sie längst verhungert. Denn auch modebewussteste Leopardinnen trügen niemals Schuhe mit Absatz, genaugenommen tragen sie überhaupt keine Schuhe und schon gar keine Pumps, nicht mal die im Zoo, bislang zumindest nicht. Von steter Gehbehinderung einmal abgesehen, verursachen jene Lauttreter einen Lärm, der noch das gutgläubigste Stück Freiwild in die Flucht schlagen würde. Wenn dieses nicht ohnehin gerade hinter einer Bürofassade festsitzt und wehmütig zum nahgelegenen Haus des Reisens blickt, von fernen Sternen träumend. Doch merke: Nicht das Tier, sondern der Mensch überwindet Zeit und Raum. Oder es amüsiert sich im Spielcasino, welches im Erdgeschoss des Zuchthauses gelegen ist, besucht die Touristensynagoge im ersten Stock, schaut auf der hundertachtzigsten Etage in den Räumen des „Arbeitgeberverband energie- und verordnungswirtschaftlicher Unternehmen“ vorbei, oder flieht zu einem der Seher und Heiler, die im Groll-Haus residieren. In jedem Fall könnte es sich keines Unterangebots berufsorientierender Perspektiven beschweren. Bekanntermaßen sucht Vieh jedoch seinen Beruf nicht selber aus.
Perspektiven eröffnen sich in einem solchen Hause ohne jedes Zutun seiner desorientierten Tagesbewohner. Das beste Beispiel dafür ist der türkische Kollege, der vorschlug, einfach ein Fenster zu öffnen und zu springen. Bungeejumping quasi, nur eben ohne Bungee. Denn während auf dem Dach des in Sichtweite gelegenen Hotelhochhauses ein regelrecht feierlicher Nervenkitzelkonsum geriert wird, liegen die Nerven im Tollhaus der Madame Groll meist blank, ohne konsumistische Initiation zu erreichen. Aufseher tragen daher eine hohe Verantwortung. Sie werden mit Steuergeldern dazu angehalten, andere davon abzuhalten, ihrer Arbeit nachzugehen und stattdessen lieber Steuergelder ins Groll-Haus zu tragen. Verständlicherweise fühlen sie sich „verarscht“, schieben die Verantwortung dafür aber auf die Tageshäftlinge. Folgen diese dem Bedürfnis, ihre Würde zu verteidigen, geraten die Wärter in Rage und drohen mit Denunziation. Infolgedessen käme es zu Bestrafungen – den Applaus des Volkskörpers noch nicht mitgerechnet.
Die Ehre, das Wachpersonal von der Arbeit abzuhalten, obliegt allein der Chefin und ihren ebenso schwatzhaften Zwillingsschwestern Mona und Fiona. Es gibt kaum ein Thema, das unbeehrt bliebe und gern dürfen dabei alle mithören. Wozu schließlich ist man Chefin, oder Chefinnengeschwister. Juristisch relevante Nachrede wird freilich lieber hinter dem Rücken in Umlauf gebracht. Dass jemand Drogen nehme, zum Beispiel. Meinen Augen sehe sie an, dass ich Drogen nehme, sagt sie vor versammeltem Publikum, sobald ich außer Hörweite bin. Darf sie das? Nun, wer wollte ihr dieses Unrecht nehmen. Haben wir einander zu tief in die Augen gesehen? Nun, wer wollte dieses Recht uns nehmen. Doch Leoparden küsst man nicht – wie schon Cary Grant es zu wissen lernte, 1938 in der Screwballkomödie Bringing Up Baby.
Glauben Sie mir bitte, dass ich sogar Verständnis aufbringe für jene üble Nachrede, denn Madame Groll ist in einem autoritären Unrechtsstaat großgeworden und muss diesbezügliche Kompetenzen heute unter verschärften Wettbewerbsbedingungen anbieten. Im Übrigen geht auch die Polizei bei jeder Kontrolle meiner Person davon aus, auf Spuren von Alkohol und Drogen zu stoßen. Fündig geworden ist sie nie und das ist auch kein Wunder, denn ausgerechnet ich habe tatsächlich noch nicht ein einziges Grämmchen Droge konsumiert und den Genuss von Alkohol immer schon gemieden. Zumindest unter diesem Gesichtspunkt wäre ich höchstgeeignet, am Hindukusch zu kämpfen, schon um gegen den Opiumanbau zu intervenieren; vielleicht mithilfe einer Division Leopard-Panzern alles plattwalzen, oder ausreichend Napalm abwerfen.
Afghanistan bietet viele Möglichkeiten, sich auszutoben. „Hast Du jemand umgebracht?“, möchte Krankenschwester Andrea aus Flensburg wissen. Doch der Soldat weiß es nicht, denn die Waffen reichten weit. Eine Explosion hat ihm eine Speiche aus dem Arm gerissen und seine Haut verbrannt. Dennoch, in Somalia war es schlimmer, sagt er. Dort sah er Frauen mit zerstoßenem Unterleib, ins Koma vergewaltigt, und Milizen, die willkürlich in die Menge schossen, Kinder mordeten. Zu gern nur hätte er das Feuer erwidert. Darf er das? Nein, er war dort, um James Bond zu spielen, sich abzuseilen auf Handelsschiffe, und für Übungssprünge bei Nacht, in Phosphorträume – das Großartigste, was er je erlebt hat, abgesehen von seiner kleinen Tochter.
Im Golf von Aden die Handelsschiffahrt zu sichern, musste dem blutjungen Unterfeldwebel genügen. Sein Camp in Afghanistan wurde bis zu fünfzigmal beschossen, täglich. Heilfroh sei er, keinen Knacks davongetragen zu haben. Viele seiner tödlichen Kollegen hatten weniger Glück. Hätte er gewusst, wie der Krieg sein würde, wäre er nicht hingegangen, sagt er. Das schnelle Geld aber hatte ihn gelockt. Der Sergeant in der zweiten Reihe nickt vielsagend, der Syrer in der dritten lupft seinen Pullover, eine Schusswunde kommt zum Vorschein. In Syrien war er dem Geheimdienst verpflichtet. Nach nunmehr drei Wochen im Groll-Haus tritt der gelernte Scharfschütze einen Job in der Berliner Wurstfabrikation an; von jeher eine „interessante“ Konstellation – ein Mohammedaner im Paradies des Schweinefleisch. Der Sergeant möchte wieder als Koch arbeiten und Schuhe tragen wie meine, ohne gemustertes Fell, ohne Tarnung, und der Syrer hofft auf Frieden, einfach Frieden nur. Doch der liegt begraben unter Drohungen, und die, die ihn begruben, tragen selbst schwer an ihnen.
Madame Groll hat daher beschlossen, für den Rest des Jahres Urlaub zu nehmen, offiziell aufgrund von Rückenleiden. Zwölf Jahre Simulation hat sie hinter sich gebracht. Also bitte, wer bräuchte dann keine Verschnaufpause! Sicher ist: Ihre erdreistlichen Schergen werden den Laden auch ohne sie schmeißen; ausreichend Steuergeld hat sich jedenfalls zusammengefunden, und an „Kunden“ wird es dem Tollhaus ohnehin nie mangeln.
Und im nächsten Jahr? Da geh ich auf Safari – mit Madame Groll auf Leopardenjagd. Wenn ich einen schieß, kriegt sie ’ne Prämie. Von uns beiden ist sie eindeutig die bessere Geschäftsfrau. C’est la vie, meine Lieben.